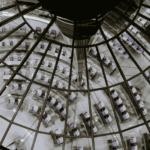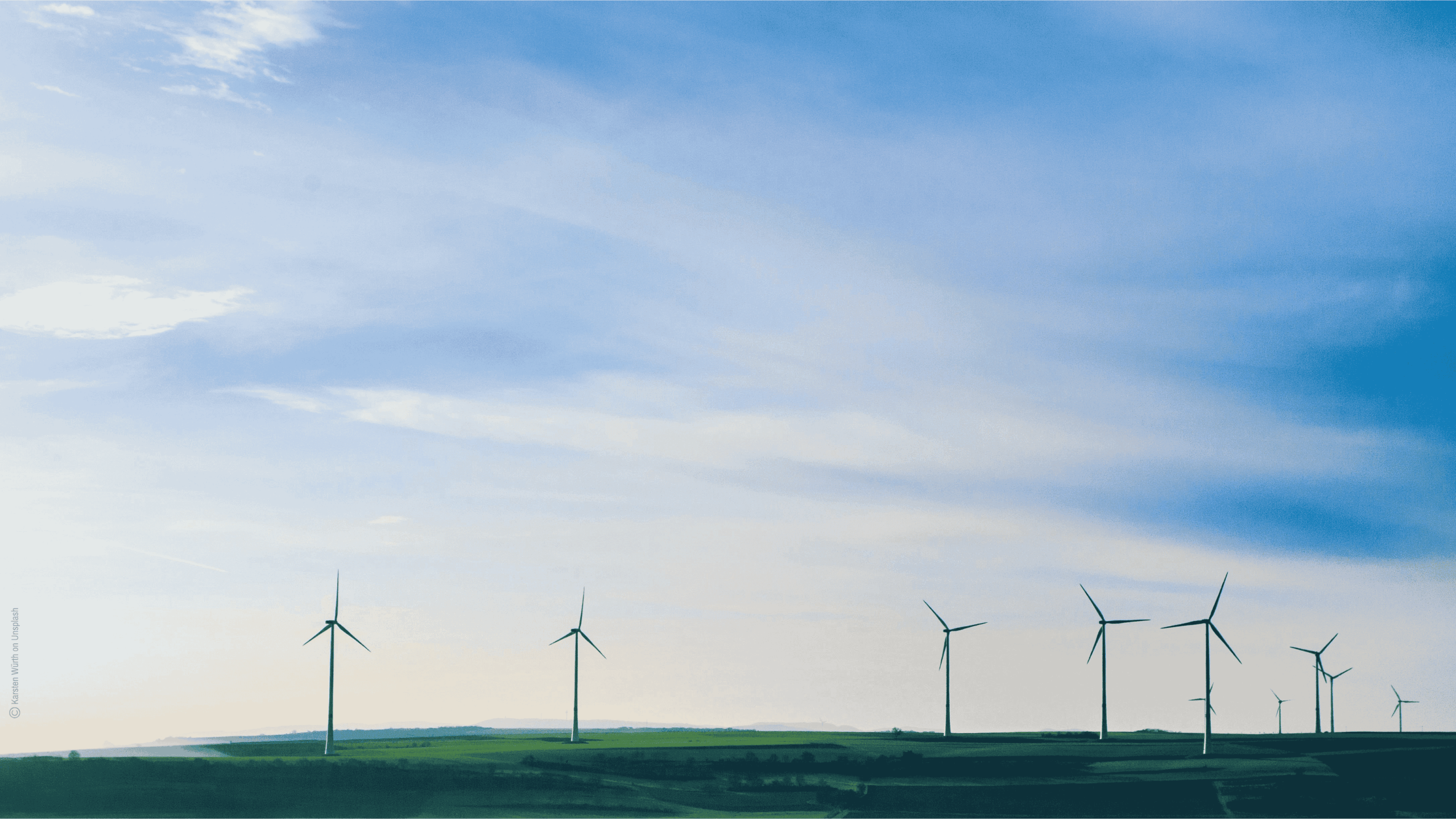Die SRzG untersucht den schwarz-roten Koalitionsvertrag in einer Serie von Blogbeiträgen. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den geplanten (und den nicht geplanten, aber notwendigen) Vorhaben in Bezug auf Energiepolitik, Klima- und Umweltschutz.
Analyse:
1. Klimaziele & Grundgesetz
- Die Koalition bekennt sich im Koalitionsvertrag zum Klimaziel des deutschen Klimaschutzgesetzes (THG-Neutralität bis 2045).
- Koalitionspartner wollen nicht über das Zwischenziel 2040 (88% Reduktion) hinaus reduzieren. Diese Einschränkung ist unverständlich. Wenn sich Wege finden lassen, in kürzerer Zeit mehr CO2 zu vermeiden, dann sollten sie auch begangen werden.
2. Emissionshandel & CO₂-Bepreisung
- Emissionshandel wird weiterentwickelt, d.h. nach dem europäischen System „EU ETS 2“ auf Verkehr, Gebäude und Gewerbe ausgeweitet. Das ist begrüßenswert, da dies eine wichtige Lenkungsfunktion für Konsum und Produktion hat und für eine gerechtere Verteilung der wahren Umweltkosten sorgt. Allerdings wollen die Koalitionspartner der Opt-in-Möglichkeit bei der CO2-Bepreisung im Sektor Landwirtschaft nicht nachkommen, sondern sie haben nur vor, sich an die verpflichtenden Teile des EU-weiten Emissionshandels zu halten: also nur das Nötigste zu machen.
3. Energiewende & Energiepolitik
Positiv: Die Regierung möchte bei der Gestaltung der Energiewirtschaft stärker als bisher die Bürger:innen miteinbinden.
- Beteiligung von Bürger:innen durch Konzepte wie „Energy Sharing“ mit einem Fokus auf erneuerbare Energien sind ein vielversprechender Ansatz.
- Aber: Geplante langfristige Gaslieferverträge, sowie Pläne für die Förderung von Gas im Inland widersprechen Klimazielen. Schließlich sollte Deutschland gemäß dem Bundes-Klimaschutzgesetz und seiner Verfassung in 20 Jahren bereits netto-treibhausgasneutral sein. Die künftige Regierung scheint diese gesetzliche Pflicht nicht ernst zu nehmen. Außerdem riskiert die Regierung neue außenpolitische Abhängigkeiten mit Gasimporten.
4. Ausbau Erneuerbarer Energien
Positiv: Nennung von Solar-, Wind-, Wasser-, Bioenergie und Geothermie.
- Kritik: Keine verbindlichen Ausbauziele und verbindliche Förderinstrumente. Leider verzichtet die künftige Koalition darauf, bestehende Ziele in diesem Bereich höher zu stecken.
- Ohne klare Vorgaben (z. B. Flächenziele, Mindestabstände) droht der Ausbau weiterhin an lokalen Blockaden und Bürokratie zu scheitern. Bürgerenergie bliebe in einem solchen Falle ein Lippenbekenntnis ohne Finanzierungs- oder Umsetzungsrahmen.
5. Verkehrswende & Elektromobilität
Mit einem Acht-Punkte-Plan soll die E-Mobilität gefördert werden. Dazu gehören die steuerliche Begünstigung von E-Autos im Allgemeinen und von E-Dienstwagen im Besonderen, ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU-Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen, der beschleunigte Ausbau eines flächendeckenden Schnellladenetzes für PKW und LKW sowie die Befreiung emissionsfreier LKWs von der Mautpflicht über das Jahr 2026 hinaus. Bei öffentlichen Ladesäulen will die Bundesregierung für Preistransparenz und technische Vereinheitlichung sorgen.
- Kritik: Flottengrenzwert von 0 CO₂-Emissionen ab 2035 (EU-Vorgabe) müsste konsequenter unterstützt werden. Nach der aktuell gültigen Regelung der EU sollen die Flottengrenzwerte bis 2035 auf null absinken, was bedeutet, dass danach nur noch Fahrzeuge neu zugelassen werden dürfen, die im Betrieb kein CO2 emittieren.
- Kritik: Gerede über Technologieoffenheit täuscht darüber hinweg, dass längst geklärt ist, welches bei PkW die beste Technologie ist, nämlich der batterieelektrische Antrieb. Diese Technologie bietet mit Abstand den besten Wirkungsgrad. Der Elektroantrieb wird auch global bald den höheren Marktanteil als Verbrenner-PkW haben, daher ist es fatal, dass deutsche Automobilunternehmen in diesem Zukunftsmarkt schwächeln. Der Staat muss der Kaufzurückhaltung im deutschen Heimatmarkt durch ein klares Bekenntnis zum Verkehrswendedatum 2035 begegnen.
6. Carbon Capture & Storage (CCS/CCU)
- CCS/CCU sinnvoll, aber Potenzial darf nicht überschätzt werden. Die Fördermaßnahmen dürfen nicht von primären Reduktionsmaßnahmen ablenken. Gefahr: CCS als Ausrede für weiter hohen CO₂-Ausstoß (z. B. bei „Luxury Emissions“). CCS/CCU sollten und müssen in Verbindung mit Reduzierungen der individuellen und kollektiven CO2-Emissionen genutzt werden. Dafür ist eine Unterstützung des Konzeptes des individuellen CO2-Fußabdrucks nötig, worüber sich im Koalitionsvertrag aber nichts findet.
7. Kohleausstieg
- Die künftige Koalition hält am Ziel fest, erst bis zum Jahr 2038 die Verbrennung von Braunkohle zur Energiegewinnung einzustellen. Ein Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 ist aber notwendig, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten.
·
8. Luftverkehr & Kurzstreckenflüge
- Kritik: Keine Regulierung zur Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf Bahn. Ohne solche verbindlichen Schritte bleibt der Flugverkehr, der auf Kurzstrecken bis 1.000 km rund 25-mal mehr CO₂ pro Passagier verursacht als die Bahn, ein klimapolitischer Blindfleck. Ein konsequentes Verbot von Kurzstreckenflügen bei parallelem Hochgeschwindigkeitszug-Ausbau, wie in Frankreich, könnte den Weg zur THG-Neutralität um Jahre verkürzen.
- Kritik: Schwächung bestehender Nachhaltigkeitsziele im Luftverkehr (z. B. SAF-Quoten) konkret bei der Power To Liquid-Quote und bei der Sustainable Aviation Fuel-Quote (KoaV S.8).
- Forderung: EU-weite Regelung mit 4-Stunden-Bahn-Alternative als Standard. Die europäisch koordinierte Verkehrsverlagerung von der Luft auf die Schiene kann und muss von Deutschland in die europäischen Gremien eingebracht werden.
9. Bildung & Beteiligung junger Menschen
- Fehlende Vorschläge für konkrete Beteiligung junger Menschen an Klima- und Energiepolitik. Gerade im Bereich Klima und Energie wäre hier eine vermehrte Einbindung junger Menschen bei Planung und Umsetzung förderlich.
- Vorschlag der SRzG: Einrichtung eines Jugend-Klimarats als Ergänzung zum Deutschen Klimarat. Der Deutsche Klimarat (ein wissenschaftliches Beratungsgremium, das seit 2023 die Bundesregierung beim Klimaschutz berät), sollte einen Jugend-Klimarat als unterstützendes Begleit-Gremium bekommen. Eine formalisierte Rolle junger Menschen in klimapolitischen Gremien würden die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz steigern.
Zum Kontext: Die SRzG untersucht den Koalitionsvertrag in einer ausführlichen Stellungnahme auf das Thema Generationengerechtigkeit. Darin fokussiert sie sich auf zentrale Politikfelder wie Begriffliche Verankerung der Generationengerechtigkeit, Institutionelle Reformen, Klimaschutz, Umwelt und Energie, Atomare Endlagerung, Staatsverschuldung und Investitionen, Alterssicherung, Gesundheit und Pflege, Wehrdienst und Bildung.