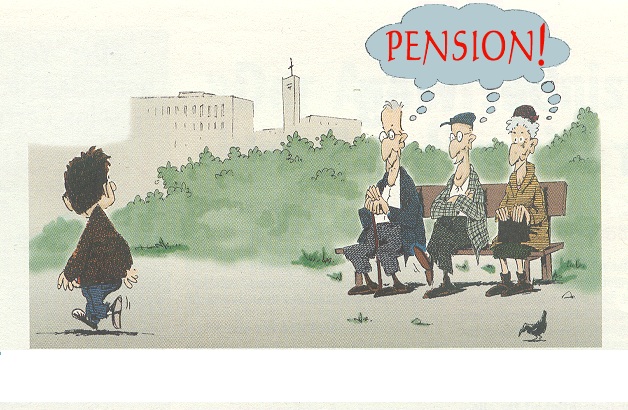Im Juli 2025 veröffentlichte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) einen Artikel mit dem Titel „Ohne direkte Mehrbelastung der Jungen: „Boomer-Soli“ kann wichtiger Baustein für Stabilisierung der Rente sein“. Das Papier löste sofort eine heftige öffentliche Diskussion aus.
Der Vorschlag eines Boomer-Soli weist in die richtige Richtung, es muss aber über die genaue Ausgestaltung diskutiert werden. Schaut man sich den Begriff an, also eine Solidaritätsleistung der Baby-Boomer-Generation, dann kommt man erst mal zu einer anderen Ausgestaltung als sie der Vorschlag des DIW vorsieht. Dieser „eigentliche“ Boomer-Soli wird nachfolgend zuerst dargestellt, danach werden die Unterschiede zum DIW-Modell ausgeführt.
Eine Soli-Steuer für die Boomer-Generation
Was ist die Ausgangslage? Durch den Renteneintritt der Babyboomer, der geburtenstarken Jahrgänge, gerät das Rentensystem zunehmend unter finanziellen Druck. Der Koalitionsvertrag sieht trotzdem eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis zum Jahr 2031 vor. Ohne Stabilisierung würden sie laut der Rentenformel auf 47 Prozent bis 2031 sinken (vgl. Rentenversicherungsbericht 2024, Abschnitt 3.1, Teil B, siehe auch hier). Die Mehrausgaben, die sich aus der Stabilisierung ergeben, sollen mit Steuermitteln ausgeglichen werden, was den Bundeszuschuss stark ansteigen lassen wird – laut aktuellem Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas bis 2031 auf insgesamt ca. 24,7 Mrd. € (vgl. hier). Soviel wird also zusätzlich zum heutigen Bundeszuschuss aus Bundesmitteln benötigt, um das separate Ziel zu verwirklichen, das Rentenniveau bei 48% einzufrieren. (Insgesamt beträgt der Bundeszuschuss ein Vielfaches dieses Betrags von rund 25 Mrd. €. Seine anderen Bestandteile haben aber auch konkrete sozialpolitische Aufgaben, wie die Mütterrente oder die Anrechnung von Studienzeiten in der Rente).
Nun kann man sich schon fragen, warum diese zusätzliche Summe von 25 Mrd. von uns allen bezahlt werden soll. Denn es geht ja um den Ruhestandseintritt der Babyboomer, also der Jahrgänge 1955 bis 1972. Es ist also gar nicht abwegig, letztlich von dieser Generation eine Sondersteuer zu verlangen, die diese rund 25 Mrd. Euro wieder dem Staatshaushalt zuführt. Bei einer progressiven Ausgestaltung (oberhalb eines Freibetrags) würden Geringverdiener diese Sondersteuer kaum zahlen müssen, Gutverdiener hingegen schon. Das wäre hinsichtlich der Gestaltung der Steuer gerecht, weil unter der Babyboomer-Generation manche ärmer und andere wohlhabender sind. Für die Finanzämter wäre ein zeitlich begrenzter, (d.h. solange das Problem eben anhält, also bis der Babyboomer-Buckel „durchgewandert“ ist) Soli verwaltungstechnisch kein Problem – damit kennen sie sich seit dem Solidaritätszuschlag für die Kosten der Deutschen Einheit aus. Die Generation, die für den Babyboomer-Buckel verantwortlich ist, würde so ihre Verantwortung schultern.
Das ist bisher nicht Programmatik der SRzG, aber ein bedenkenswerter Vorschlag. Schon die Debatte darüber ist wichtig! Die Boomer-Generation zeigt bisher vor allem Unverständnis für die Probleme der Jüngeren in der Rentenversicherung und sie hat eine falsche Anspruchshaltung. So denken sich viele 65jährige: „Nach einem Leben voller Arbeit im Alter gut abgesichert zu sein, das steht mir zu, dafür muss der Staat jetzt sorgen.“ Aber der Staat ist die Gesamtheit der Menschen in einem Land, und wenn es weniger junge Menschen gibt, dann ist das kein sinnvoller Anspruch mehr. Tatsache ist jedoch, dass ein:e Neurentner:in oder ein:e Neupensionär:in zum Zeitpunkt des Renteneintritts nicht ein Leben lang gearbeitet haben – man hat dann, statistisch gesehen, noch viele Lebensjahre vor sich (Pensionsempfangende statistisch gesehen noch einige Jahre mehr als Rentenempfangende).
Der Vorschlag des DIW
Der Vorschlag des DIW unterscheidet sich nun von dem „Boomer-Soli“ im obigen Sinne. Zunächst wollen die sieben, meist jungen Autor:innen des Vorschlags nur solche Babyboomer der Solidaritätspflicht unterwerfen, die bereits den Wechsel vom Arbeitsleben in den Ruhestand vollzogen haben. Stand 2025 wären dies nur die Jahrgänge 1955 bis 1959, die derzeit 66 bis 70 Jahre alt sind (von Vorruheständlern einmal abgesehen). Es soll von ihnen auch keine Sondersteuer erhoben werden, sondern eine Sonderabgabe. In der Studie (S.453) heißt es erklärend: „Die Einnahmen fließen nicht in den allgemeinen Bundeshaushalt, sondern in ein Sondervermögen, das für die Umverteilung der Alterseinkünfte geschaffen wird und nur für deren Zweck verwendet werden darf. Es finanziert ausschließlich Zuschüsse an die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, gegebenenfalls auch an die Beamtenversorgung oder die berufsständischen Versorgungswerke, soweit auch in diesen Systemen geringe Alterseinkünfte aufgestockt werden sollen. Die Zuschüsse dürfen ausschließlich für die Aufwertung von geringen Versorgungsansprüchen der Versicherten verwendet werden.“ Ziel des DIW-Vorschlags ist also eine sozialpolitische Maßnahme, bei der ärmere Ruheständler von reicheren Ruheständlern unterstützt werden. Die Altersarmut würde dadurch von gut 18 auf knapp 14 Prozent sinken.
Fazit: Es geht beim DIW-Vorschlag nicht um eine Entlastung der Jungen, sondern – wie der Titel schon sagt – um eine Maßnahme, die die Jungen nicht (weiter) belastet. Das aber dürfte angesichts der ständig steigenden Belastungen zu wenig sein.
Einbeziehung von Abgeordneten als große Leerstelle
Im Moment besteht der größte Reformbedarf allerdings nicht im Boomer-Soli, sondern bei der Integration der verschiedenen Altersversorgungssysteme in Deutschland, v.a. des kriselnden Beamtenversorgungssystems. Den ersten Schritt müssen dabei die Abgeordneten selbst machen, die bisher nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen sind, sondern die Beamten-Altersversorgung auf sich übertragen haben, obwohl sie keine Beamte sind. Wenn auf ein kollektives Sicherungssystem schwierige Zeiten zukommen, dann ist Solidarität besonders wichtig. Bisher ist es so, dass die Abgeordneten von Beitragssatzerhöhungen oder Leistungskürzungen, die der Bundestag beschließt, nicht selbst betroffen sind. Dies führt zu legitimer Kritik in der breiten Bevölkerung. Dadurch leidet das Ansehen der Bundestagsabgeordneten sowie der soziale Frieden. Es gilt jetzt vor allen anderen Reformen, diesen ‚blinden Fleck‘ zu beseitigen, indem die ‚Gesetzesmacher‘ durch ihr Beispiel führen und vorangehen. Das ist eine Frage des Führungsstils. Im Koalitionsvertrag werden viele Reformen für die Rentenversicherung angekündigt. Aber wichtiger als das sind die Leerstellen, also die Themen, über die geschwiegen wird. So fehlt jeder Reformeifer bezüglich der Altersversorgung der Parlamentarier selbst. Konkret ist zu fordern, dass die Abgeordneten § 20 des Abgeordnetengesetzes ändern, wofür keine Zwei-Drittel-Mehrheit, sondern nur eine einfache Mehrheit erforderlich ist (vgl. auch https://abgeordnete-rein-in-die-grv.de/ mit weiterführenden Links zur Petition der SRzG).“