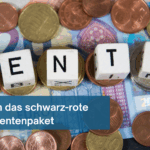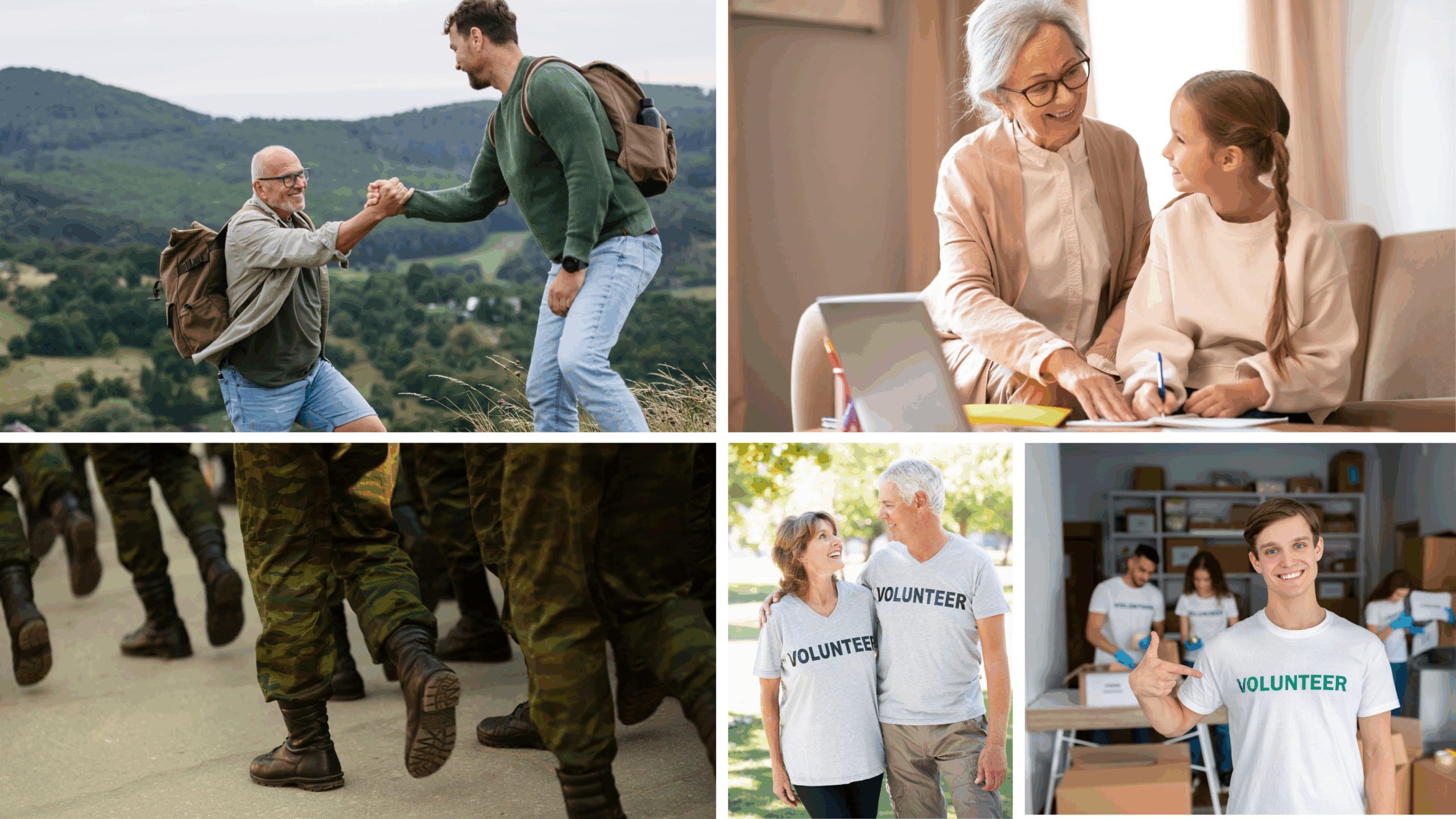Von Ben Jagasia und Linda Kunz (SRzG-Botschafterkreis).
Nach langer Diskussion konnte sich die Bundesregierung Mitte November 2025 auf eine Wehrdienstreform einigen. Angesichts der unfriedlichen Weltlage und der Herausforderungen für Deutschland war eine solche Einigung längst überfällig. Wer jedoch eine grundlegende Reform erwartet hatte, wurde enttäuscht: So hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, zur Musterung müssen. Der Wehrdienst soll jedoch weiterhin auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Nur wenn sich nicht genügend Wehrdienstleistende melden, wird eine ‚Bedarfswehrpflicht‘ aktiviert, die eine Verpflichtung zum Wehrdienst durch ein Losverfahren vorsieht. Diese Bedarfswehrpflicht kann jedoch nur mit Zustimmung des Bundestages in Kraft treten. Zudem soll die Wehrerfassung durch einen verpflichtenden Fragebogen gestärkt werden.
Eine umfassende Reform des Wehrdienstes in Deutschland bleibt also aus. Stattdessen hält die Bundesregierung am Modell eines freiwilligen Wehrdienst fest und fügt diesem lediglich einige verpflichtende Elemente hinzu.
Die SRzG hält diese Herangehensweise für unzureichend. Es wird versäumt, die grundlegenden Herausforderungen des Wehrdienstes anzugehen. Die SRzG fordert einen umfassenderen Ansatz, um den sozialen Zusammenhalt und die Wehrfähigkeit in Deutschland zu stärken. Viele Expertinnen und Experten bezweifeln, dass das Ziel, die NATO-Zielmarke von 260.000 aktiven Soldaten, sich damit erreichen lassen wird (aktuell sind 180.000 Soldaten). Die Pflichtmusterung ist eine notwendige Voraussetzung für ein mögliches späteres Losverfahren und wird insofern von der SRzG begrüßt. Aber grundsätzlich nur Männer zur Musterung einzuladen und notfalls zu verpflichten, entspricht nicht den Gleichheitsprinzipien des Art. 3 Grundgesetz. Es ist anachronistisch und steht im Widerspruch zu modernen Organisationsprinzipien von Armeen, in denen beide Geschlechter gleichberechtigt und gleichverpflichtet dienen, wie in Norwegen oder Israel.
Auch ist es bedauerlich, dass mit dem nun eingebrachten Gesetzentwurf nicht die Möglichkeit genutzt wurde, ein modernes Dienstmodell zu schaffen, das einen sozialen Dienst mit einem Dienst an der Waffe gleichgewichtet. Der Name des Gesetzentwurfs spricht Bände: „Wehrdienstreform”. Was wir aber brauchen ist eine Wehr- und Zivildienstreform, die sowohl Männer als auch Frauen sowie Jung und Alt mitbedenkt. Ein Dienstmodell, das ausschließlich die junge Generation betrifft, verschärft die Verteilung der Lasten in unserer Gesellschaft auf junge Menschen.
Der angestrebte Wehrdienst richtet sich auf die junge Generation, die zahlenmäßig schrumpft und bereits überproportional unter den Folgen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen leidet. Sie ist zudem mit zahlreichen wirtschaftlichen, sozialen und globalen Herausforderungen konfrontiert. Fakt ist: Junge Menschen sind bereits jetzt stark belastet und finden zunehmend schwierigere Startbedingungen vor. DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat die Lage treffend zusammengefasst: „Nie in den letzten 80 Jahren wurde einer jungen Generation eine Welt mit so vielen großen Problemen und Krisen vererbt wie der jungen Generation heute.” [1] Eine Wehr- und Zivildienstreform, die sich ausschließlich an die junge Generation richtet, legt eine zusätzliche Last auf ihre Schultern. Die SRzG argumentiert, dass ein Dienst, der nur junge Menschen in die Pflicht nimmt, nicht generationengerecht ist und das Prinzip der Solidarität sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergräbt. Es besteht die Gefahr, dass ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen eine Entscheidung treffen, die junge Menschen in die Pflicht nehmen, während die Älteren selbst unbeschadet „von der Seitenlinie aus“ beobachten. Diese gerontokratische Struktur führt zu einer ungleichen Verteilung der Verantwortung und verstärkt das Gefühl der Entfremdung zwischen den Generationen. Ein generationengerechtes Dienstmodell müsste daher über die Fixierung auf das frühe Erwachsenenalter hinausgehen und auch Menschen am Ende ihrer Erwerbsphase einbeziehen. Die SRzG plädiert dafür, Pflichtzeiten in zwei Lebensphasen zu verankern: einmal vor dem Einstieg ins Berufsleben und einmal nach dessen Abschluss, vor dem Renteneintritt. Diese Pflichtzeiten könnte man sowohl bei der Bundeswehr als auch im sozialen Bereich ableisten, zum Beispiel in den Krankenhäusern, bei der Tafel oder in den Schulen. Durch die Teilnahme an solchen Diensten können ältere Generationen aktiv bleiben, sich wertgeschätzt fühlen und ihr Wissen sowie praktisches Können in die Gesellschaft einbringen. Dies würde auch der Einsamkeit im Alter entgegenwirken und Sinn stiften. Denn besonders wichtig ist, dass der soziale Zusammenhalt zwischen Jung und Alt nachhaltig gestärkt wird. Missverständnisse zwischen den Generationen, mangelndes Einfühlungsvermögen und fehlende Kommunikation schaffen Barrieren, die das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft behindern. Je besser wir andere Generationen kennen, desto besser verstehen wir sie. Indes können Jung und Alt durch ihre unterschiedlichen Perspektiven voneinander lernen. Ein generationengerechtes Dienstmodell könnte somit nicht nur die Wehrfähigkeit unseres Landes sichern, sondern auch den sozialen Zusammenhalt zwischen den Generationen in der Gesellschaft stärken. Lehrt uns die Geschichte nicht, dass Gesellschaften mit größerem sozialem Zusammenhalt besser mit Krisen umgehen können?
[1] https://www.deutschlandfunk.de/diw-praesident-fratzscher-warnt-vor-rechtsruck-bei-junger-generation-zukunftsaengste-berechtigt-100.html. Zur Vertiefung siehe auch: Fratzscher, Marcel (2025): Nach uns die Zukunft. (Berlin, Berlin Verlag).
Zur weiteren Vertiefung:
Positionspapier der SRzG,
https://generationengerechtigkeit.info/wp-content/uploads/2025/11/PP-Dienst-2025-2.-Aufl.-Nov-2025.pdf
Gesetzentwurf,
https://dserver.bundestag.de/btd/21/018/2101853.pdf
Anhörung zum Gesetzentwurf,
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw46-pa-verteidigung-wehrdienstmodernisierung-1117340
Bundeswehr – Freiwillig oder Pflicht: Welches Heer brauchen wir? Ein Vortrag des Militärsoziologen Heiko Biehl.
https://podcasts.apple.com/de/podcast/h%C3%B6rsaal-deutschlandfunk-nova/id828868503?i=1000733336833